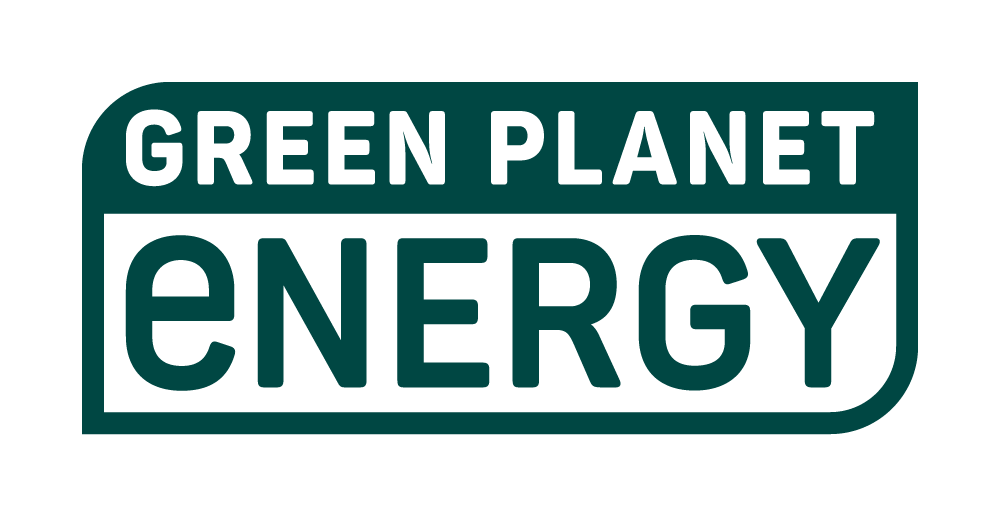Das Klimageld war eines der großen Versprechen der Ampel-Koalition, wurde aber in der letzten Legislaturperiode nicht eingeführt. Zuerst lag das an fehlender technischer Infrastruktur, um das Geld auszuzahlen. Später fehlte das Geld im Haushalt und der politische Wille zur Umsetzung. Letztendlich konnten sich die Koalitionspartner FDP, SPD und Grüne nicht auf ein gemeinsames Konzept einigen. Dabei ist das Klimageld wichtig, um die Belastungen durch höhere CO₂-Preise auszugleichen – aber allein reicht es nicht, um die Energiewende sozial gerecht zu gestalten.
Warum das Klimageld?
In Deutschland wird seit 2021 ein CO₂-Preis im Bereich Verkehr und Gebäude erhoben. Das Tanken mit Benzin und Diesel und das Heizen mit Gas und Heizöl wird so von Jahr zu Jahr teurer. Der Sinn dahinter: Menschen und Unternehmen erhalten einen wirtschaftlichen Anreiz, auf die klimafreundliche Wärmepumpe oder das E-Auto umzusteigen. Da diese Preissteigerungen vor allem einkommensschwache Haushalte stark belasten, soll das Klimageld die finanzielle Belastung abfedern.
Die CO₂-Preise steigen jährlich an. Hinzu kommt: 2027 wird der nationale CO₂-Preis in ein europaweites System überführt – der sogenannte ETS 2 (ETS=Emission Trading Scheme, Emissionshandel). Forscher:innen und Politik warnen davor, dass die immer weiter ansteigenden Kosten einige Bürger:innen finanziell überfordern. Das setzt Vertrauen und Akzeptanz für die Energiewende aufs Spiel. Deswegen ist es eine der dringendsten Aufgaben der nächsten Bundesregierung, das Klimageld auf den Weg zu bringen. Wichtig dabei: Es kommt auf die Ausgestaltung an.
Warum ein sozial gestaffeltes Klimageld?
Menschen spüren die finanziellen Belastungen durch steigende Energiepreise unterschiedlich stark. Besonders Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen sind betroffen. Denn sie geben einen großen Teil ihres Einkommens fürs Heizen und Tanken aus. Preissteigerungen machen sich daher direkt an der Zapfsäule oder bei der Heizkostenabrechnung bemerkbar.
Laut Berechnungen von Greenpeace und dem Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) können Haushalte mit geringem Einkommen mit bis zu 650 Euro pro Jahr zusätzlich belastet werden. Für mittlere Einkommen können die Mehrkosten sogar bis zu 1.200 Euro im Jahr betragen. Haushalte mit höherem Einkommen spüren diese steigenden Kosten dagegen kaum. Deshalb ist es wichtig, gezielt Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten, um den gesellschaftlichen Rückhalt für die Energiewende zu sichern. Ein sozial gestaffeltes Klimageld kann dabei helfen.
Das Klimageld in den Wahlprogrammen der Parteien
Wie sehen die Vorschläge der Parteien dazu aus? Wir haben die Positionen in einer Wahlprogrammanalyse zusammengefasst und bewertet. Positiv ist, dass viele Parteien (CDU/CSU, Grüne, SPD, FDP, Linke) ein Klimageld / Klimabonus / Klimadividende einführen wollen. Allerdings fordern nur die Grünen, die Linke und die SPD eine soziale Staffelung des Klimageldes. Bei der CDU/CSU und der FDP fehlt diese wichtige Dimension. Häufig werden auch pauschale Senkungen der Stromsteuer oder Netzentgelte als vergleichbare Mechanismen genannt. Zwar werden dadurch die Stromrechnungen für alle billiger. Relativ gesehen profitieren jedoch höhere Einkommen mehr davon als niedrigere. Kostensenkungen nach dem „Gießkannenprinzip“ sind weniger effektiv darin, untere und mittlere Einkommen zu erreichen. Deswegen ist es wichtig, dass das Klimageld mit einer sozialen Staffelung verbunden wird.
Klimageld = sozial gerechte Energiewende?
Das Klimageld allein ist noch kein Garant für eine soziale Energiewende. Es gleicht nur die steigenden CO₂-Kosten aus. Menschen mit weniger Einkommen werden aber noch nicht in die Lage versetzt, in neue, klimaneutrale Technologie zu investieren – zum Beispiel in eine Wärmepumpe oder ein E-Auto. Dafür brauchen wir inklusivere und sozialere Fördersysteme.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Die Fördermittel für klimaneutrale Technologien wurden vor allem von gutverdienenden Privatpersonen im erwerbsfähigen Alter mit hoher Qualifikation abgerufen. Solche Personen können sich umfangreiche Investitionen leisten. In Deutschland liegt das Median-Einkommen bei ca. 2.100 Euro im Monat. Das bedeutet: Mehr als die Hälfte aller Einkommen liegt darunter. Viele haben also nicht das notwendige Geld, um in eine teure neue Heizung oder ein neues E-Auto zu investieren.
Wenn diese Personen jedoch nicht in die Lage versetzt werden, auf klimaneutrale Technologien umzusteigen, zahlen sie durch die steigenden CO₂-Preise immer mehr Geld. Ein Teufelskreis (auch genannt „Lock-In-Effekt“), der nur durchbrochen wird, indem wir existierende Förderprogramme sozialer gestalten. Ein gutes Beispiel dafür ist die einkommensabhängige Förderung der Ampel-Regierung für den Heizungstausch – sie sieht einen Einkommensbonus für Menschen mit geringerem Einkommen und einen vergünstigten Zinskredit vor.

Green Planet Energy fordert: Klimageld als eine Priorität für die nächste Bundesregierung
Die soziale Dimension der Energiewende wird eine der zentralen Herausforderungen für die nächste Bundesregierung sein. Ein sozial gestaffeltes Klimageld ist ein wichtiges Werkzeug, damit die Energiewende geringe und mittlere Einkommen nicht ausschließt. Deswegen muss es eine Priorität für die nächste Regierung sein, die technische Infrastruktur und den Auszahlungsmechanismus für das Klimageld schnell umzusetzen. Aber es braucht noch weitere politische Antworten, damit alle mitmachen können. Zum Beispiel: sozial ausgerichtete Förderprogramme, besseren Zugang zu Krediten und Investitionen in öffentliche Infrastrukturen.
So können wir alle von der Energiewende profitieren.